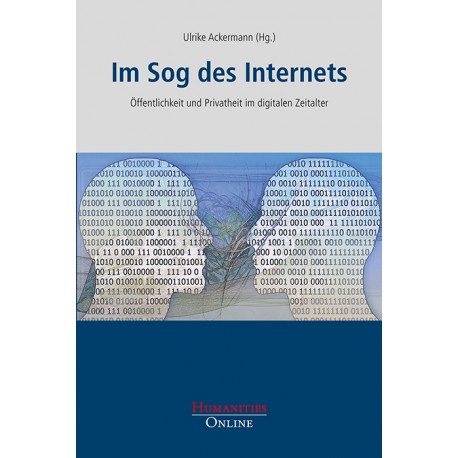
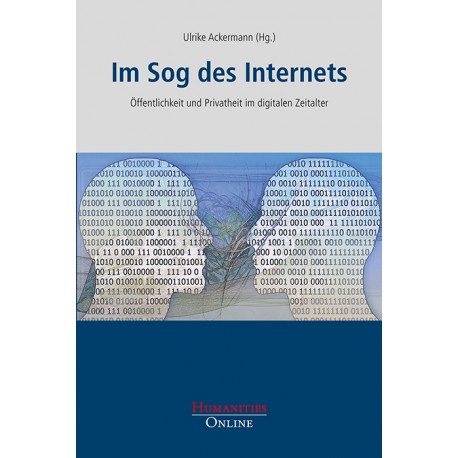
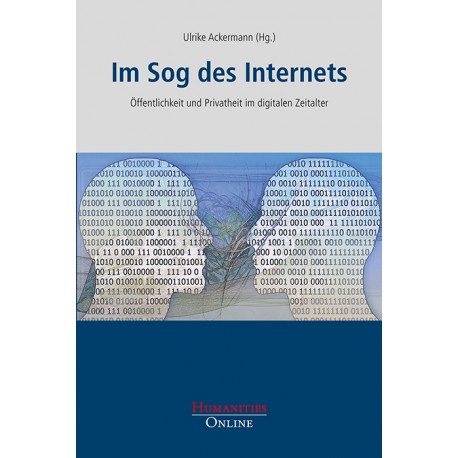

Ulrike Ackermann (Hg.)
Im Sog des Internets
Öffentlichkeit und Privatheit im digitalen Zeitalter
200 Seiten, broschiert
Frankfurt am Main 2013
ISBN 978-3-941743-35-9
Buch 19,80 Euro
E-Book (PDF) 13,80 Euro
Immer tiefer durchdringt das Internet unser alltägliches Leben. Es ist überall verfügbar, seine Anwendungen sind zunehmend unverzichtbar, aber sie haben auch Folgen. Wir sind eben erst dabei zu verstehen, wie die digitale Revolution die Parameter unseres Lebens verschiebt und was angemessene Reaktionen darauf sein könnten. Der vorliegende Band greift das Thema unter dem Aspekt von Öffentlichkeit und Privatheit auf. Autoren aus verschiedenen Feldern der Wissenschaft loten in politischen, historischen, soziologischen und kulturwissenschaftlichen Perspektiven aus, welche Chancen und Risiken die digitale Revolution für die Öffentlichkeit und Privatheit birgt, die Eckpfeiler jeder freiheitlichen Gesellschaft sind.
Inhalt
Ulrike Ackermann
Einleitung 7
Max-Otto Baumann
Datenschutz im Web 2.0: Der politische Diskurs über Privatsphäre in Sozialen Netzwerken 15
Göttrik Wewer
Die Verschmelzung von privater und öffentlicher Sphäre im Internet 53
Larry Frohman
Rethinking Privacy in the Age of the Mainframe: Integrated Information Systems, the Changing Logic of Privacy, and the Problem of Democratic Politics in Surveillance Societies 71
Marcel Berlinghoff
»Totalerfassung« im »Computerstaat« ? Computer und Privatheit in den 1970er und 1980er Jahren 93
Carsten Ochs
Wettrüsten der Skripte: Widersprüchlichkeiten soziotechnischer Privatheitspraktiken im Internet 111
Philipp Aumann
Control – Kommunikationstechniken als Motoren von Entprivatisierung und Fremdsteuerung 131
Hans Jörg Schmidt
Mark Zuckerberg und die alten Römer. Oder: Utopie der Offenheit und Historisierung des Privaten im ?digitalen Zeitalter? 151
David Gelernter The Danger to Privacy Posed by Technology and Culture Working Together 159
Forschungsbibliographie 174
Die Autoren 195
Ist das Internet tatsächlich eine gefährliche Krake, die uns die bisher verteidigte Privatsphäre raubt und die Chancen der Selbstbestimmung schmälert, wie es Kulturkritiker in deutschen Feuilletons befürchten? Oder eröffnet es im Gegenteil ganz neue Möglichkeiten individueller Selbstentfaltung und Freiheitsgewinne für jeden, die wir in diesem Ausmaß bisher überhaupt noch nicht kannten? Wie verändern sich unser Verständnis von und unser Umgang mit Privatheit im Zuge der digitalen Revolution? Wenn sich virtuelle und reale Kommunikation vermischen und vervielfachen, müssen dann neue Spielregeln geschaffen werden? Wie wandeln sich die Strukturen der Öffentlichkeit? Und wie gestaltet sich das Verhältnis von privater und öffentlicher Sphäre neu? Die gesellschaftliche Debatte darüber hat erst begonnen. Die Politik scheint von den rasanten Entwicklungen bisher eher überfordert. Und die Wissenschaft macht sich gerade daran zu untersuchen und zu verstehen, wie die digitale Revolution die Parameter unseres alltäglichen Lebens verschiebt.
Der vorliegende Band versammelt die ersten Forschungsergebnisse, die das John Stuart Mill Institut für Freiheitsforschung federführend in Kooperation mit der Universität Heidelberg in dem Projekt »Privatheit und Öffentlichkeit im digitalen Zeitalter« erarbeitet hat.
An vorderster Stelle steht die Studie von Max-Otto Baumann, die er als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts durchgeführt hat. Ausgangspunkt war die immense Bedeutung, die Soziale Netzwerke inzwischen in jedermanns Alltagsleben einnehmen: Kommunikation, Vernetzung, Partizipation oder Shopping, all dies findet inzwischen vornehmlich dort statt. Es ist ein sozialer »Rahmenwechsel« (Erving Goffman), der das Handeln aller beteiligten Akteure beeinflusst: gewinnorientierte Unternehmer als Anbieter sozialer Netzwerke ebenso wie Politiker, die angehalten sind, die Privatsphäre der Bürger zu schützen, und natürlich die alltäglichen Nutzer. Deshalb hat uns vor allem die Frage interessiert, wie die Politik den Privatsphärenschutz in Sozialen Netzwerken diskutiert und welche Aufgaben sie für sich daraus ableitet. Daran schließt sich gleich die weitergehende Frage an: Darf, soll oder muss die Politik sich um die Privatsphäre ihrer Bürger kümmern? Und sind, wenn ja, Regulierungsmaßnahmen in welchem Ausmaß gerechtfertigt? Wo beginnt und wo endet Datenschutz?
Im ersten Teil seiner Arbeit stellt Max Baumann verschiedene theoretische Perspektiven auf die Privatsphäre und ihren Wandel vor. Sodann rekonstruiert er mittels einer quantitativen und qualitativen Inhalts- und Diskursanalyse den politischen Diskurs über Soziale Netzwerke, wie ihn die im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien seit 2009 führen. Im letzten Abschnitt werden die Ergebnisse zusammengeführt in einen Kommentar aus liberaler Perspektive. Augenfällig ist, dass die Funktionen der Privatsphäre, wie etwa Autonomie, emotionaler Ausgleich und Reflexion, von Sozialen Netzwerken gefährdet werden: durch Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten zur Profilbildung, Manipulation durch Werbung, soziale Kontrolle durch Transparenz, die wiederum tendenziell Konformität begünstigt und Kreativität ersticken kann.
Die Inhalts- und Diskursanalyse fördert zu Tage, dass die Regierungsparteien CDU/CSU und FDP ein optimistisches Narrativ über den digitalen Wandel und dessen großes Potential propagieren, das sich am besten ohne die Einmischung der Politik und neuen Regulierungen entfalten könne. SPD, Grüne und Linkspartei betonen in ihrem Gegennarrativ die Risiken eines unkontrolliert ablaufenden digitalen Wandels. Kern der Debatte ist das Thema Selbstbestimmung und Autonomie. Für CDU/CSU und FDP steht der selbstbestimmte Nutzer im Vordergrund, der in eigener Verantwortung selbst entscheidet, was er tut und preisgibt. Staatliche Regulierung sei in diesem Felde deshalb unnötig. Zugleich wägen sie zwischen Privatsphäre und anderen Gütern ab: etwa dass Unternehmen aufgrund strenger Datenschutzregeln Deutschland als Wirtschaftsstandort negativ bewerten könnten. Die Oppositionsparteien sehen hingegen die Nutzer prinzipiell überfordert und trauen ihnen nicht zu, autonom und eigenverantwortlich ihre Privatsphäre zu schützen. Der politische Streit kreist also darum, wer die Verantwortung für den Schutz der Privatsphäre zu tragen hat: Nutzer, Unternehmer oder der Staat? Die Vorschläge zur Regulierung reichen denn auch vom Selbstdatenschutz bis zur EU-Regulierung. Pikanterweise verkehren sich die Positionen der Parteilager auf Länderebene in Abhängigkeit davon, ob sie die Regierungs- oder die Oppositionsrolle innehaben.
In seinem abschließenden Plädoyer für Datenschutz entwickelt Baumann eine interessante Perspektive, die das Verhältnis von Freiheit, Autonomie des Bürgers und Aufgabe des Staates neu auslotet. Haben die Bürger historisch ihre Freiheitsrechte gegen den Staat erstreiten müssen, so hat sich die Problemlage im Zuge der digitalen Revolution verändert: die Privatsphäre müssen die Bürger nicht nur gegen Übergriffe des Staates, sondern auch gegenüber monopolistischen Großunternehmen wie Google, Facebook etc. verteidigen. Zugleich ist der Staat laut Grundgesetz verpflichtet, die Persönlichkeitsrechte und die Privatsphäre seiner Bürger zu schützen. Da die großen Internetunternehmen seit Jahren propagieren, das Konzept der Privatsphäre sei völlig überholt, stellt sich die Frage, wie der Staat schützend eingreift, um das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und Wahlfreiheit zu gewährleisten. Dazu könnten Datenschutzregulierungen zählen wie das Kopplungsverbot von Service und Datenhandel, das die Nutzung von Internetdiensten ohne erzwungene Weitergabe personenbezogener Daten ermöglichen würde. Ein »Recht auf Vergessen« und die Pflicht zur Löschung ist ebenso vorstellbar wie ein Profilbildungsverbot oder zumindest wirksame »Opt-in«- und »Opt-out«-Regelungen. Auch liegt es im Aufgabenfeld des Staates, für mehr Wettbewerb zu sorgen. Zudem würde die rechtliche Einklagbarkeit von Datenschutzstandards, deren Verletzungen mit Gewinn abschöpfenden Sanktionen belegt wären, die Position der Nutzer gegenüber den Anbietern erheblich stärken. Wirksamer Datenschutz hätte zudem auch noch eine einhegende Wirkung auf den Staat selbst. Beim Datenschutz handelt es sich also um ein Anliegen und zugleich eine große aktuelle Herausforderung des Liberalismus. Die Studie von Max-Otto Baumann ist flankiert von Untersuchungen und Betrachtungen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen, die die Forscher erstmals auf einer Konferenz in Heidelberg zusammengetragen und für diesen Band ausgearbeitet haben.
Göttrik Wewer stellt sich die Frage, inwieweit heute überhaupt noch »private« Daten von »öffentlichen« Daten zu unterscheiden sind. Wenn der Ruf nach totaler Transparenz immer lauter wird, der Verrat von Geheimnissen als eine Form von Zivilcourage gefeiert wird, dann bröckelt der gesellschaftliche Grundkonsens, die Privatsphäre sei ein schützenswertes Gut, auf beunruhigende Weise. Vom Zeitalter der »Post-Privacy« ist schon die Rede. Wewer schildert die Debatte darüber und beobachtet, wie sich das Verhalten im Netz verändert. Neue Formen der virtuellen Selbstinszenierung und öffentlichen Selbstdarstellung charakterisieren eine sich wandelnde Jugendkultur. Zugleich verändert sich der Umgang mit Information, wenn jeder sein eigener Reporter ist und im Netz keine Qualitätskontrollen die Informationen filtern. In welchem Maße die unsortierte Vielfalt und Twitterwalls den Erkenntnisgewinn der Nutzer steigern oder mindern, steht noch in Frage. Es scheint zuweilen, Kommunikation gerate zum reinen Selbstzweck. Zugleich entstehen neue Kulturtechniken des Kopierens, Ausschneidens, des neu Zusammenfügens, Verlinkens und Remixens, die das bisherige Verständnis von individueller Kreativität, Originalität und Autorschaft ablösen.
Laut einer Umfrage des Branchenverbands BITKOM misstrauen die Nutzer zwar in großer Mehrheit der Sicherheit der Sozialen Netzwerken und fordern besseren Datenschutz. Doch die Zahlen von Facebook oder Google belegen, dass sich die Nutzer letztlich über ihre eigenen Bedenken hinwegsetzen. Für Wewer ist im Zuge der digitalen Revolution die Privatsphäre durch den Staat, die Wirtschaft und die Nutzer selbst, die das Internet mit ihren privaten Daten füttern, unter Druck geraten. Letztere sind gewissermaßen Täter und Opfer zugleich.
Larry Frohman rekonstruiert in seiner Arbeit, wie sich das Verständnis von Privatsphäre und Persönlichkeitsrechten in Deutschland in den letzten Jahrzehnten auch auf der Ebene der Rechtsprechung verändert hat. Er nimmt unter anderem Rekurs auf den Richterspruch des Bundesverfassungsgerichts anlässlich der Volkszählung 1983, in dem erstmals die »informationelle Selbstbestimmung« definiert wurde. Bereits 1969 hatte das Gericht von der Privatsphäre als einem schützenswerten Innenraum gesprochen, in dem der Bürger »sich selbst besitzt«, sich zurückziehen kann, in Ruhe gelassen wird und ein Recht auf Einsamkeit genießt. Die Trennung zwischen öffentlicher und privater Sphäre verbunden mit der Überzeugung, dass letztere die Basis für individuelle Freiheit und Selbstbestimmung ist, gehört zu den Prämissen des modernen Liberalismus. Die ursprünglich vom Bürgertum erkämpfte Privatsphäre hat sich aber seit Ende des 19. Jahrhunderts aufgrund des Aufstiegs der Massenmedien und der Tendenz der Kommerzialisierung privat-intimer Information erheblich gewandelt. Erst recht steht die Privatsphäre unter Beschuss, seitdem moderne Bürokratien immer ausufernder routinemäßig und massenhaft persönliche Daten der Bürger erheben. Während der klassisch liberale Staat sich vornehmlich um die physische Sicherheit der Menschen, die Durchsetzung des Vertragsrechts und der Eigentumsrechte kümmerte, hatte er wenig Bedarf, allzu viel über seine Bürger zu wissen ? das lag natürlich auch an den bis dato nicht vorhandenen technischen Möglichkeiten. Der moderne Wohlfahrtsstaat hingegen, der sich um die Gesundheit, den Wohlstand und die Produktivität der Bevölkerung kümmert, erhebt zu diesem Zweck detaillierteste persönliche Informationen seiner Bürger ? zu ihrem Besten versteht sich. Dies ist gewissermaßen der Preis für Sicherheit, Für- und Vorsorge des Staates, den er seinen Bürgern abverlangt. Zugleich können wir über die Jahrzehnte einen Strukturwandel der Information beobachten. Die Revolution der Informationstechnologie hatte in den 1960er und 1970er Jahren weitreichende Folgen für die administrative Handhabung der öffentlichen und privaten Datenerfassung ? z.B. in Form der sogenannten Amtshilfe. Das Konzept der informationellen Selbstbestimmung reagiert auf diese Entwicklung, um der Entstehung eines Überwachungsstaats Einhalt zu gebieten.
In Anknüpfung an Frohman untersucht Marcel Berlinghoff aus zeithistorischer Perspektive den »Computerstaat« und das Verständnis von Privatheit im Deutschland der 70er und 80er Jahre. In den Protesten gegen die Volkszählung 1983 kulminierte das Unbehagen gegenüber der Computerisierung der Gesellschaft und v.a. die Angst vor einem Überwachungsstaat. Die gesellschaftlichen Debatten pendelten viele Jahre zwischen Kulturpessimismus und Fortschrittsoptimismus. Doch die Gewöhnung an den Computer sorgte in den 80er Jahren dafür, dass sich die Angst vor den Folgen der neuen Technologie allmählich verflüchtigte. Noch in den 70er und 80er Jahren verstand man unter Computerisierung hauptsächlich eine unkontrollierte technische Gleichschaltung, die quasi alle Lebensbereiche kolonisiere. Hinzu traten staatliche Überwachungsansprüche, die, so die Befürchtung, die individuelle Privatsphäre ebenso gefährden wie das demokratische Gemeinwesen insgesamt. Doch bereits Mitte der 80er Jahre kann man eine Entdämonisierung des Computers beobachten. Er stand nun für Modernität und Zukunftsoffenheit.
Carsten Ochs setzt sich in seiner Studie mit den unterschiedlichen soziotechnischen Privatheitspraktiken auseinander, die er empirisch untersucht hat. Er unterscheidet zwischen Digital Natives, technikaffinen und technikdistanzierten Nutzern. Alle haben normative Vorstellungen von Privatheit, die sich auf Körper (Intimität), Raum (Privatsphäre) und Wissen (persönliche Informationen) beziehen. Die Mehrheit der Nutzer fordert ein Recht auf »Privacy in Public«. Die Technikdistanzierten haben ein stark ausgeprägtes Kontrollbedürfnis hinsichtlich der Informationsflüsse und geben den Privatheitsnormen das größte Gewicht. Aufgrund ihrer höheren Kompetenz verfügen die Technikaffinen über einen wesentlich souveräneren Umgang mit dem Internet und halten etwaige Risiken für beherrschbar. Die Digital Natives weisen ein moderates Kontrollbedürfnis auf und schätzen das Risiko gering ein. Im Zweifelsfall würden sie allerdings ihre Vorstellungen von Privatheit dem Bedürfnis nach Sozialität unterordnen. Im Umgang mit Privatheit im Netz konkurrieren letztlich drei verschiedene Skripttypen: die praktisch-normativen der Nutzer, die technischen Skripte der technischen Agenten und die regulatorischen Skripte der Rechtsprechung. Gegenstand dieses Wettstreits der unterschiedlichen Skripte ist die Beobachtbarkeit oder Erfahrbarkeit jedes Einzelnen und deren Einschränkung, d.h. die Ermessung dessen, was Privatheit in Abgrenzung zu Öffentlichkeit ist. Und diese verändert sich sukzessive mit jeder neuen Anwendung und jeder neuen Nutzungsweise.
Philipp Aumann stellt in seinem Beitrag den Begriff der Kontrolle ins Zentrum, die als Sozialtechnik Öffentlichkeit herstellt und Privatheit abbaut. In Anlehnung an Michel Foucault sieht er allein schon in der Möglichkeit der Überwachung und der Androhung von Strafe einen informellen Normierungsdruck. Generell sieht Aumann im Internet einen ganz bedeutenden Katalysator sozialer Kontrolle: Im Netz verschmelzen, so Aumann, Überwacher und Überwachte miteinander, indem die Nutzer Bilder von sich selbst präsentieren und sich damit der Sichtbarkeit der anderen ausliefern. Mit dieser Selbstpreisgabe geht just jener Raum des Privaten verloren, in dem das Individuum sich frei vom Normierungsdruck staatlicher, unternehmerischer und sozialer Kontrolle entfalten und kreativ sein könnte. Jörg Schmidt ordnet in seinem Beitrag die Ideen des Erfinders von Facebook, Marc Zuckerberg, in den Diskurs über den Wandel des Verhältnisses von Privatheit und Öffentlichkeit ein. Der Weg in die fluide Gesellschaft der Netzwerke ist begleitet von Segmentations-, Integrations- und Entgrenzungsprozessen. Der Facebook-Gründer propagiert sehr selbstbewusst seine Utopie einer Gemeinschaft der »sozialen Mit-Teilung«. Bereits zu Anfang des Netzwerks begrüßte er jeden neuen Nutzer auf dessen Profil mit der Feststellung, von nun an diene er der Gemeinschaft. Inzwischen ist Zuckerberg stolz auf seinen Erfolg: »Die Privatsphäreneinstellung von 350 Millionen Nutzern zu ändern, hätte sich nicht jedes Unternehmen getraut«, sagte er 2010. Als bekennender Freund der alten Römer hebt er hervor, dass für sie der Begriff des Privaten eine negative Note hatte. Man ging im Rom der Antike davon aus, dass Dinge, die man nicht öffentlich macht, Dinge sind, die man verbergen will. Er schlussfolgert nun daraus: »Vielleicht ist Privatheit in der Moderne leicht überbewertet.«
Dem widerspricht ganz entschieden David Gelernter, der zum Abschluss des Forschungsprojekts auf Einladung des John Stuart Mill Instituts nach Heidelberg kam. Der These, die Technologie zerstöre die Privatsphäre, hält er entgegen, dass wir selbst es sind, die sie zu Grabe tragen. Für ihn ist die kollektive Widerstandskraft von Privatheit und menschlicher Würde leider schwächer als die überaus attraktive Macht eines Massenpublikums. Und das Internet ist das bisher größtmögliche Massenpublikum in unserer bisherigen Geschichte. Er konstatiert, dass die westlichen Gesellschaften ein ambivalentes Verhältnis gegenüber der Privatheit haben. Die Neugierde hat größte Errungenschaften hervorgebracht, war und ist aber zugleich der Antrieb, alles über den anderen wissen zu wollen. Das soziale Spektrum reicht von der Einsamkeit an einem Ende bis zum öffentlichen Bekenntnis am anderen Ende. Starkult, Exhibitionismus und Voyeurismus untergraben die Privatsphäre. Anhand einiger Beispiele aus Literatur und Bildender Kunst betont er den zentralen Stellenwert, den die Privatsphäre in der westlichen Kultur-, Sozial- und Geistesgeschichte innehat. Privatheit und Einsamkeit sind Güter, die wir trotz des stärker werdenden sozialen Drucks verteidigen müssen.
Ziel des Forschungsprojekts, das im Übrigen mit freundlicher Unterstützung der Klaus Tschira Stiftung weitergeführt wird, ist es, die Wahrnehmung und das Bewusstsein für die Möglichkeit digitaler Selbstbestimmung und Mündigkeit zu schärfen: auf Seiten der Nutzer des Internets, also den Bürgern ebenso wie bei politischen Entscheidungsträgern und wirtschaftlichen Akteuren. Der immense Strukturwandel im Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit im Zuge der digitalen Revolution verändert bereits jetzt unser Alltagshandeln, Selbstverständnis und unsere Mentalitäten. Die Analyse und Deutung dieser Wandlungsprozesse wird weiterhin im Fokus unserer Forschung stehen. Es geht nicht zuletzt darum, ob diese revolutionären Entwicklungen uns einen Zugewinn an Freiheit bescheren oder bisherige Freiräume und Handlungsoptionen einschränken. In jedem Fall ist es im Ermessen unserer jeweiligen individuellen Freiheit, wie wir uns im Internet bewegen. Über Regeln, die diese Freiheit auch unter den sich ständig verändernden Bedingungen schützen, müssen wir uns immer wieder neu verständigen.
Die Herausgeberin
Prof. Dr. Ulrike Ackermann, Sozialwissenschaftlerin, ist Professorin für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Freiheitsforschung und -lehre sowie Gründerin und Direktorin des John Stuart Mill Instituts für Freiheitsforschung.